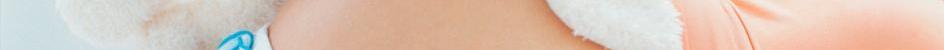besondere Erkrankungen in der Schwangerschaft
Besondere Erkrankungen in der Schwangerschaft
Toxoplasmoseinfektion
Die Toxoplasmoseinfektion ist eine weit verbreitete Krankheit. Der Erreger wird vor allem durch Tierkontakt, z. B. Katzenkot, durch den Genuss von infizierten Nahrungsmitteln (rohes Fleisch) sowie Gartenarbeiten übertragen. Die Toxoplasmoseinfektion kann sich durch uncharakteristische Symptome wie Lymphknotenschwellung im Halsbereich, Fieber, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen und allgemeine Abgeschlagenheit bemerkbar machen, meist verläuft sie aber symptomlos. Außerhalb der Schwangerschaft gilt eine Toxoplasmoseinfektion als harmlos und hinterlässt lebenslange Immunität.
Eine Erstinfektion in der Schwangerschaft kann zu einer Übertragung auf das ungeborene Kind führen und eine Fehlgeburt, Totgeburt oder schwere Schädigung insbesondere des kindlichen Gehirns auslösen. Auch wenn das Kind bei Geburt normal erscheint, kann es nach vielen Monaten oder Jahren Schäden des Zentralnervensystems und der Augen entwickeln. Das Risiko für eine Schädigung des Kindes nimmt bis zum Ende der Schwangerschaft zu. Besteht dagegen mütterliche Immunität aufgrund einer Toxoplasmoseinfektion vor der Schwangerschaft, ist bei dieser und jeder nachfolgenden Schwangerschaft das werdende Kind vor einer Infektion geschützt. Eine einfache Blutentnahme kann Ihren Immunstatus ermitteln. Da eine routinemäßige Testung auf eine Toxoplasmoseinfektion nicht in den Mutterschaftsrichtlinien enthalten ist, handelt sich dabei um eine Blutentnahme, die Sie selber bezahlen müssen (IGeL).
Das Ziel dabei ist es, ein mögliches Risiko oder das Bestehen einer Erstinfektion in der Frühschwangerschaft frühzeitig zu erkennen, da eine rechtzeitige Antibiotikagabe Ihr Kind vor Folgeschäden schützen kann. Sollte bei Ihnen keine Immunität bestehen, wird die Blutuntersuchung alle 8-12 Wochen wiederholt.
Unabhängig davor sollten Sie sich vor einer möglichen Toxoplasmoseinfektion in der Schwangerschaft schützen, indem Sie rohes Obst, Gemüse und Salat vor dem Verzehr gründlich waschen, die Hände nach der Zubereitung von rohem Fleisch und nach Gartenarbeit vor dem Essen mit Seife und Handbürste reinigen, Ihre Katze mit Dosen- und / oder Trockenfutter füttern und das Katzenklo täglich von einer anderen Person mit heißem Wasser säubern lassen.
B-Streptokokkeninfektion
Während der ersten drei Lebenstage sind Neugeborene gegenüber einer generellen Infektion (Sepsis) mit ß-hämolysierenden Streptokokken besonders gefährdet. Die Folge ist eine lebensgefährliche Erkrankung mit hoher Todesrate, insbesondere wenn ein Befall des Gehirns erfolgt.
Das Kind kann beim Geburtsvorgang durch ß-hämolysierende Streptokokken, welche die Scheide der Mutter besiedeln, infiziert werden. Sie merken eine solche Scheideninfektion normalerweise nicht, da ß-hämolysierende Streptokokken meist keine Symptome verursachen. Die Infektion des Kindes wird durch frühes Platzen der Fruchtblase mit verlängerter Wehendauer begünstigt. Durch Antibiotikagabe während der Geburt lässt sich die Infektion in den meisten Fällen vermeiden.
Durch eine mikrobiologische Untersuchung (Abstrich) in der 35.-37. Schwangerschaftswoche kann eine Besiedelung Ihrer Scheide mit Streptokokken festgestellt werden, sollte dies der Fall sein, werden Sie zur Geburt ein Antibiotikum erhalten. Eine Therapie vor der Geburt ist nicht zu empfehlen, da in der Zwischenzeit häufig eine neue Streptokokkeninfektion auftritt.
Eine routinemäßige Testung auf eine Streptokokkeninfektion ist nicht in den Mutterschaftsrichtlinien enthalten, es handelt sich dabei um einen Abstrich, den Sie selber bezahlen müssen (IGeL).
Cytomegalievirus
CMV gehört zu der Gruppe der Herpesviren, einmal erkrankt, bleibt man immer Virusträger (40-70% der Bevölkerung). In Situationen der körperlichen Immunschwäche kann das Virus wieder ausbrechen, die Infektion verläuft aber im Allgemeinen ohne Krankheitszeichen. Übertragen wird das Virus über Tröpfchen, also Urin, Tränen, Blut, Speichel, Samen- und Vaginalflüssigkeit und Muttermilch.
Erfolgt eine Erstinfektion in der Schwangerschaft, kann dies mit schwerwiegenden Folgen für Ihr Baby einhergehen (Organschädigungen, geistige Behinderung, etc). Sind Sie als werdende Mutter bereits CMV-Trägerin, ist die Gefahr für Ihr Baby nur sehr gering. Zur Behandlung einer solchen Infektion steht ein Medikament zur Verfügung, das die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung Ihres Babys reduziert.
Eine routinemäßige Testung auf eine CMV-Infektion ist nicht in den Mutterschaftsrichtlinien enthalten, es handelt sich dabei um eine Blutentnahme, die Sie selber bezahlen müssen (IGeL).
Gestationsdiabetes (Schwangerschaftszucker)
Als Schwangerschaftsdiabetes (= Gestationsdiabetes) bezeichnet man eine erstmalig während der Schwangerschaft erkannte Störung des Blutzuckerstoffwechsels. Risikofaktoren sind z.B. das Alter (> 35 Jahre), das Körpergewicht (> BMI 25), Gestationsdiabetes bei vorangegangenen Schwangerschaften und die Familiengeschichte (nahe Verwandte mit Diabetes). Die Häufigkeit des Schangerschaftsdiabetes ist seit mehreren Jahren deutlich steigend, in Deutschland entwickeln 2-4% aller Schwangeren einen Gestationsdiabetes. Obwohl für die Mutter ein langsamer Blutzuckeranstieg in der Regel beschwerdefrei verläuft, kann für das Kind bereits eine Gefährdung bestehen.
Die Höhe des Blutzuckerspiegels hängt von der Ernährung und den blutzuckerregulierenden Hormonen ab. Dabei senkt Insulin den Blutzuckerspiegel. Einige Schwangerschaftshormone erhöhen dagegen den Blutzuckerspiegel und bewirken so einen ansteigenden Insulinbedarf. Kann dieser erhöhte Insulinbedarf durch eine Mehrproduktion nicht ausgeglichen werden, entwickelt sich ein Gestationsdiabetes. Ernährungsfehler begünstigen diese Entwicklung.
Über den Mutterkuchen (Plazenta) und die Nabelschnur gelangen die Nährstoffe der Mutter zum Kind, das mit einer erhöhten Insulinproduktion auf das mütterliche Glukoseangebot reagiert. Mögliche Folgen sind dann übermäßiges Wachstum des Kindes, das dicker und größer wird (Makrosomie), eine starke Zunahme der Fruchtwasserbildung und eventuell eine Mangelversorgung des Kindes durch eine Durchblutungsstörung des Mutterkuchens (Plazentainsuffizienz). Diese Faktoren erhöhen insbesondere das Risiko für Früh- und Totgeburten sowie die Kaiserschnittrate.
Frauen mit einem Schwangerschaftsdiabetes entwickeln häufiger Infektionen im Genitalbereich und der Harnwege. Außerdem kann ein schwangerschafts-bedingter Bluthochdruck mit einer vermehrten Eiweißausscheidung (Prä-eklampsie) entstehen.
Beim Säugling können nach der Geburt Anpassungsstörungen, wie Unterzuckerung, schwere Gelbsucht (Ikterus) und Atemnot auftreten.
Um das Risiko für Mutter und Kind zu erkennen, empfiehlt es sich, in der 24.-28. Schwangerschaftswoche einen Screeningtest auf Schwangerschaftsdiabetes (GDM-Screening) durchzuführen. Sollte der Test den Verdacht auf einen Schwangerschaftsdiabetes ergeben, wird ein Blutzuckerbelastungstest angeschlossen. Sollte der den Verdacht bestätigen, werden Sie einem Diabetologen vorgestellt, der mit Ihnen eine Therapieplan (Ernährungsumstellung) erstellt und gegebenenfalls eine intensivierte Betreuung mit Insulingabe durchführt. Auch ich werde Sie dann häufiger untersuchen, um das Wachstum und die Entwicklung Ihres Kindes intensiv zu beobachten.